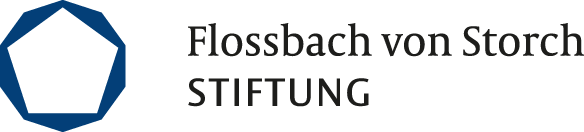OeBiX-Schwerpunktstudie: Ökonomische Bildung im Zentralabitur
Mehr Schein als Sein!
Mit der Studie „Ökonomische Bildung im Zentralabitur“ legt das Institut für Ökonomische Bildung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eine qualitative Untersuchung vor, die analysiert, in welchem Maß ökonomische Bildungsinhalte in den Zentralabituraufgaben vorkommen. Außerdem haben die Forschenden untersucht, in welchen Fächergruppen und Bundesländern Schülerinnen und Schüler eine zentrale Abiturprüfung mit ökonomischen Bildungsinhalten ablegen können. Die OeBiX-Schwerpunktstudie Zentralabitur wurde nun auf das Jahr 2023 ausgedehnt und ergänzt die OeBiX-Studien zum Stand der Ökonomischen Bildung in Deutschland, zur Lehrkräftefortbildung und zu schulischen sowie den Hochschulcurricula.