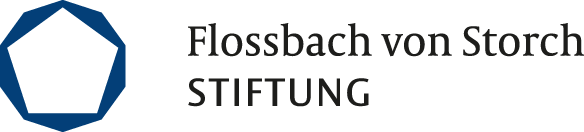Erneut schlechtes Zeugnis für Ökonomische Bildung in Deutschland
Das Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat für die Flossbach von Storch Stiftung die OeBiX-Studie aktualisiert, verfeinert und legt erneut einen umfassenden Überblick über die institutionelle Verankerung der Ökonomischen Bildung an deutschen Schulen und Hochschulen vor.
Der im Zuge dessen entwickelte Index Ökonomische Bildung in Deutschland (OeBiX) gibt an, wie gut die strukturellen Rahmenbedingungen für die Ökonomische Bildung in einem Bundesland sind. Der OeBiX-Gesamtindex misst mit seinen beiden Teilindizes Schule und Lehrkräftebildung, wie weit die Anforderungen erfüllt sind, damit ökonomische Bildungsinhalte vollwertig als Nebenfach zum einen in der Schule unterrichtet, zum anderen aber auch in Lehramtsstudiengängen an der Hochschule gelehrt werden können. Erhoben wurden unter anderem Stundenkontingente, Belegpflichten, fachdidaktische Professuren und ökonomische Studienanteile.
Nun hat das IÖB den OeBiX methodisch verfeinert und aktualisiert. So wurde die Analyse der zwischenzeitlich realisierten Schwerpunktstudie zur Ökonomischen Bildung in den schulischen Lehrplänen und in den Hochschulcurricula in den Index integriert. Die aufgrund des angepassten methodischen Vorgehens genaueren und aktualisierten Ergebnisse werden im Folgenden präsentiert.